BalsaMico - Experimente mit Flächen aus Vollbalsa |
Ich habe keinen wirklich robusten Flieger! Einen, den man an einem starken Gummi hoch in die Luft katapultieren kann. Einen, der auch mal einen groben Aufschlag verkraftet. Einen, den man auch an einem steinigen Hang noch landen kann. Immer, wenn ein Treffen der IG-Nurflügel Schweiz naht, kommt der Wunsch nach einem solchen Flieger wieder hoch.
Aus Holz soll die Fläche sein, wie alle meine Flieger. Warum nicht aus Vollholz? Jedelsky-Flächen gibt es bereits seit mehr als 70 Jahren. Robert Schweißgut benutzt dieses Prinzip für viele seiner Modelle, verwendet dafür jedoch speziell gefräste Profilbretter. Diese müsste man entweder extra bestellen (umständlich) oder selbst zurechtschleifen (staubig ohne Ende). Kann man eine Fläche für ein fliegendes Brett nicht auch aus unprofilierten Balsabrettern zusammensetzen, die es in jedem Modellbauladen zu kaufen gibt? Und wie fliegt so etwas?
Man vergleiche einmal diese beiden Profilzeichnungen:
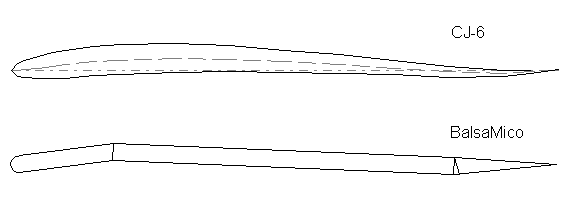
Das CJ-6 stammt zwar aus den Anfangszeiten der Modell-Nurflügel, soll jedoch recht leistungsfähig sein. Eine recht ähnliche Form kann man aus mehreren flachen Brettern und einer Dreiecksleiste zusammensetzen. Der S-Schlag ergibt sich durch die Dreiecksleiste, die so angesetzt ist, dass die Oberseite der Fläche eben ist. Die Unterseite ist damit nach oben gezogen. Der Computer nennt für dieses "Profil" ein Profilmoment cm0 von -0,02. Ich traue diesem Wert zwar nicht so ganz, immerhin ist er jedoch ein Anhaltspunkt.
 |
 |
 |
 |
Bei ruhigem Sommerwetter verliefen die folgenden Testflüge problemlos. Ich musste zu Anfang lediglich stark Seite gegentrimmen. Später stellte ich fest, das ein Flächenende schwerer ist als das andere und auch ein Flächen-Ohr etwas verdreht angeleimt war. Für stabiles Gleiten braucht die Höhenruder-Klappe nicht hochgestellt zu werden. Das Profilmoment ist also OK, scheint sogar noch Reserven zu haben. Anfängliches langgezogenes Pumpen, bei losgelassenem Höhenruder, verschwand fast völlig, nachdem ich den Akku einen Zentimeter weiter nach vorne geschoben hatte. Um die Längsachse fliegt das Modell recht wackelig, was aber kein Wunder ist, wenn man die leichten Flächenenden und das geringe Gesamtgewicht bedenkt.
Sogar einen kurzen Thermikflug, gemeinsam mit zwei Bussarden, konnte ich bei diesen ersten Tests absolvieren. Nach ein paar Umdrehungen habe ich jedoch abgebrochen, weil mir der Flieger bereits zu weit entfernt war. Bei 15 qdm Fläche ist die Sichtgrenze halt schnell erreicht.
Vorläufiges Fazit: Das Prinzip funktioniert! Damit ist der Weg frei für weitere Experimente und größere Modelle. Die Flugleistung des kleinen Dinges kann sich schon jetzt sehen lassen.
Später habe ich die Flügelbefestigung per Flächengummi durch eine Nylonschraube ersetzt und den 35 MHz-Empfänger durch ein 2,4 GHz-Exemplar getauscht. Auf Reisen wird der kleine Flieger einfach mit ins Auto gepackt und bei Gelegenheit in die Luft geworfen. Leider ist im Rumpf nicht genügend Platz für ein Variometer. 's is' halt ein Testmodel.
Die nächste Frage, die mich beschäftigte, war: Wie einfach kann man auf diese Weise einen Flieger bauen?
Also wurde die Tragfläche diesmal ungeknickt gelassen. Servos in der Tragfläche steuern über kurze Anlenkung die Höhen-Tiefen Ruder (Elevons). Die Flosse braucht kein bewegliches Seitenruder und besteht einfach aus Vollbalsa. Der Rumpf ist direkt mit der Tragfläche verbunden. Der Akku wird von unten über eine Klappe in den Rumpf eingeschoben. Der Bau dauerte nicht viel länger als zwei Wochenenden.
Daß es sich hier um keinen gemütlichen Thermikfloater handeln würde, war mir klar. Trotzdem glaubte ich, im Rumpf genügend Platz für ein Variometer vorsehen zu müssen. Leider hatte ich mich bei der Kalkulation der Länge der Rumpfnase vertan. Der Schwerpunkt ließ sich nicht mit Hilfe des vorgesehenen Akkus einstellen, sondern nur mit einem größeren und schwereren. Damit wurde es plötzlich verdammt eng im Rumpf. Mit eigentlich zu weit hinten liegendem Schwerpunkt wagte ich den ersten Flug. Mannomannomann! So ein giftiges Teil hatte ich noch nie geflogen! Es ging zu wie auf der Achterbahn. Nur mit viel Glück und Konzentration habe ich den Flieger heil auf die Wiese zurück bringen können. Mit so weit wir möglich nach vorne gepressten Akku herrschte dann flugzeugähnliches Verhalten. Aber immerhin: Er ist geflogen!
Nach längerer Denkpause habe ich mich dann doch entschlossen, das Schwerpunktproblem von der Wurzel auszurotten. Der eigentlich elegante Rumpf wurde schräg abgeschnitten und um 2 cm nach vorne verlängert.
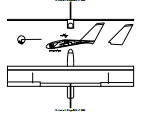 |
 |
 |
 |
 |
An einem schönen ruhigem Juninachmittag 2012, mit fast keinem Wind, hatte ich dann ausführlich Gelegenheit, Flugverhalten und Flugleistungen zu studieren. Geflogen wurde zunächst mit einem dreizelligen Akku mit 900 mAh Kapazität, was ein Abfluggewicht von 350 g ergibt und nicht ganz senkrechtes Steigen ermöglicht. Was mich als erstes überraschte, waren die Flugleistungen. Einfach nur vor sich hingeflogen, war ein sehr guter Gleitwinkel und recht geringes Sinken zu bemerken. Dabei stellte ich fest, dass der Flieger um alle Achsen eigenstabil fliegt, also auf Störungen sanft und gemächlich wieder in die Normalfluglage zurückkehrt. Immerhin hat er ja keinerlei V-Form, daher rechnete ich mit einer Neigung zum Spiralsturz. Die Stabilität um die Längsachse erkläre ich mir mit der Bauart als Hochdecker, also Gewichtsschwerpunkt unter der Tragfläche, und mit der hoch aufragenden Flosse, verbunden mit einer nicht allzu großen Richtungsstabilität. Wenn der Flieger in Querlage gerät, fängt er an über die hängende Fläche zu rutschen, also an zu schieben. Der scheinbare Wind weht dann mehr aus Richtung der hängenden Fläche und erzeugt an der Flosse Auftrieb auf der Seite der steigenden Fläche. Das erzeugt ein rückstellendes Schiebe-Roll-Moment, bringt die Tragfläche also wieder in die waagerechte.
Das Steuerungsverhalten entsprach in etwa den Erwartungen, die man an ein so leichtes Fliegerchen mit Elevons haben kann. Die Wendigkeit ist gut. Rollen gehen so mit Ach und Krach. Loopings gehen ohne Motorhilfe weder positiv noch negativ, der Durchzug (Masse) ist zu gering. Mit Motorhilfe gehen sie gut, jedoch muß der Pilot hier noch an der Schönheit arbeiten. Rückenflug geht auch prima. Dazu braucht einfach nur voll Tiefenruder gegeben werden. Der Flieger macht dann einen Purzelbaum, bleibt auf dem Rücken "hängen" und läßt sich mit weiterhin voll gedrücktem Ruder durch die Gegend manöverieren. Zieht man Höhenruder langsam bis Anschlag, erziehlt man einen langsamen Sackflug, bei dem der Flieger um die Querachse zu schwingen beginnt. Frequenz etwa eine halbe Sekunde. Dabei bleibt er voll steuerbar. Wenn man sich an den Effekt gewöhnt hat, kann man für die Landung auf diese Weise gut Höhe vernichten.
Zum Schluss habe ich noch den kleinen zweizelligen Akku mit 850 mAh Kapazität ausprobiert. Das ergibt 315 g Gewicht und ein mäßiges aber sicheres Steigen. Die Flugleistungen verbessern sich durch das geringer Gewicht nicht spürbar. Bringt also nichts.
Mit dieser Verbindungsmethode lassen sich also Tragflächen mit bis zu 2m Spannweite herstellen. Sicherlich funktioniert das bei ungeteilten Flächen. Aber auch eine Steckung sollte, eingebettet zwischen den Sperrholzplatten genügend stabil sein. Damit ließen sich also auch teilbare Flächen herstellen. Zunächst sollte jedoch aus 1 cm starken Brettern ein ca. 1,5 m großer, leicht gepfeilter Segler für das 2012er Treffen der IG-Nurflügel Schweiz gebaut werden.
Um es gleich voranzuschicken: Aus dem 1,5 m Segler wurde nichts. Nach Zusammenleimen der Teile für die Tragfläche ermittelte ich die notwendige Lage des Emfängerakkus. Hierbei wurde mir klar, dass es so nicht geht. Einen kurzen Rumpfstummel hätte ich akzeptiert. Jedoch müsste ein eigentlich schon zu schwerer Akku über 20 cm vor der Nase plaziert werden. Einen so langer Rumpf wollte ich nun doch nicht. Damit hat sich dieses Thema erst einmal erledigt.
Fazit: Das Prinzip funktioniert nur bei Modellen aus dünnen Bretter und einem Rumpf, der ordentlich Gewicht nach vorne bringt - also bei relativ kleinen Elektro-Fliegern mit Zugantrieb. Größere Tragflächen müsste man aus Balsabrettern verschiedener Stärken zusammensetzen - vorne dickere schwerere, hinten dünnere leichtere. Hier sind mir jedoch bisher keine zündelnden Ideen gekommen - außer man benutzt doch wieder gefräste Teile, so wie Robert das macht.